Der
schlichte
Saalbau
im
Stil
des
Barock
entstand
bereits
1747.
Die
Bauinschrift
ist
noch
an
der alten Portalbekrönung sichtbar.
Die
Orgel
wurde
um
1810
hinzugefügt.1855
fand
unter
Leitung
des
Großherzoglichen
Kreisbaumeisters
Rhumbler
die
erste
gründliche
Renovierung
statt.
Die
evangelische
Kirche
zu
Weinheim
wurde
1891/1892
umfassend
im
neugotisch-orientalischen
Stiel
erneuert.
Hierbei
wurde
mit
Unterstützung
des
Georg
Neidlinger
auch
eine
völlige
Neuausstattung
des
Kircheninneren
vorgenommen.
Hierbei
wurde
von
Georg
Neidlinger
auch
ein
neuer
Ofen
und
ein
elektrisches
Licht
gestiftet.
1923-1927
fand
aufgrund
der
Baufälligkeit
des
Dachreiters
der
Neubau
des
Kirchenturms
statt.
Es
wurde
eine
Orgel
(möglicherweise
aus
der
Stumm-Werkstatt)
sowie
eine
neue,
von
Eichenholz
dominierte
Ausstattung,
welche
auf
die
Kanzel
ausgerichtet
war,
angeschafft.Während
des
2.
Weltkrieges
wurden
die
im
romanischen
Stil
des
Schnorr von Carlosfeld gemalten Bilder der Kanzel zerstört.
Sie
wurde
erstmals
962
als
Besitz
des
Trierer
Klosters
St.
Maxim
in
einer
Bestätigungs-urkunde
des
Kaisers
Otto
I.
erwähnt.Der
Kirchhof
(heutiger
Friedhof)
wurde
möglicherweise
als
Wehrhof
genutzt.In
der
Galluskirche
faden
sich
verschiedene
Baustile
vereint.
Zum
einen
das
für
damalige
Zeiten
typische
Satteldach,
der
romanische
Baukörper
ohne
Geschoßgliederung
(11.
Jhd),
das
Obergeschoß
mit
frühgotischer
Klangarkade
(1200),
das
dreischiffige
flachgedeckte
Langhaus
über
dem
romanischen
Grundriß,
auf
welchem
eine
spätgotische
Kirche
errichtet
wurde,
welche
nach
Süden
verschoben
ist
und
ein
frühgotischer
Chor
sowie
ein
kleines
Doppelfenster
an
der
Südseite
der
Kirche
(1200).
An
der
Nordseite
die
gotische
Tür
aus
dem
14.Jhd.,
sowie
ein
zweigeschossige
Sakristei
an
der
Südseite
sind
einige
der
bedeutensten
Hinweise
auf
die
baugeschichtliche
Entwicklung
der
katholischen
Kirche
zu
Weinheim.Zur
Ausstattung
der
Kirche
sind
besonders
der
romanische
Taufstein
(ca.
1200),
die
Reste
des
aus
1496
stammenden
Kirchengestühls,
die
Statue
der
Muttergottes
aus
der
Mitte
des
18.
Jhd.,
das
Kruzifix
(18.
Jhd.),
die
Statuen
des
Paulus
und
des
Petrus
(18.
Jhd.),
die
Holzfigur
des
heiligen
St.
Gallus
mit
Bör
und
die
Statue
des
Bonifatius
(beides
19.
Jhd.)
sowie
der
Grabstein
des
Pfarrers
Schieffelt
(gest.
23.4.1499)
und
das
Gemälde
„Abschied
des
Tobias
von
den
Eltern“
aus
der
ersten
Hälfte
des
17.
Jhd.,
welches
an
der
Rückwand
der
Empore
befindlich
ist,
aufzuzählen.
Von
dem
mittelalterlichen
Pfarrhaus
jedoch
welches
anstelle
des
heutigen
alten
(gebaut
1766)
katholischen
Pfarrhaus stand, existieren jedoch keinerlei Spuren mehr.
Geschichtliche Kurzübersicht Weinheim


Bereits seit prähistorischer Zeit sind in Weinheim menschliche Spuren nachzuweisen. In den nächsten Zeilen möchten wir Ihnen,
in einer Kurzfassung diese Entwicklung vorstellen. Danach folgend sehen Sie einige Bilder nennenswerter Gebäude Weinheims mit
Kurzbeschreibung.

Vor und Frühgeschichte
Mittelalter
Kirchengeschichte
Kirchen und weitere Gebäude
Kath. Pfarrkirche St. Gallus
Evangelische Kirche

Das Straßenbild der Hauptstraße wir geprägt von:
Poppenmühle
Sie
wurde
von
der
Selz
betrieben
und
erstmals
1585
erwähnt.
Benannt
wurde
sie
nach
einem
früheren
Besitzer,
der
mit
Vornamen
Poppo
hieß.
1706
erstmals
umgebaut
handelt
es
sich
um
einen
stimmungsvollen
Hof,
mit
Pavillon
und
barockem
Brunnen,
der
mit
gedrehten,
von
Weinranken
umwundenen
Säulen
und
farbig
gefasster
Skulptur
der
thronenden
Muttergottes
versehen
ist.


Hausnummern 7, 11 und 13



Hausnummer 9
Hierbei
handelt
es
sich
um
ein
um
1900
errichtetes
zweigeschossiges
Wohnhaus
in
Giebellage
mit
von
der
Straße
abgesetztem
Putzbau.
Es
ist
mit
nahezu
allen
wesentlichen Details erhalten geblieben.


Hausnummern 33
Dies
ist
ein
um
die
Jahrhundertwende
für
Wilhelm
Meitzler
errichtetes
Wohnhaus,
dessen Innern wichtige Teile der Ausstattung bewahrt wurden.


Hausnummer 34


Hausnummer 114


Fritz Erler Straße
Sie
wurde
nach
dem
Fraktionsvorsitzendem
der
SPD
des
deutschen
Bundestages,
Fritz
Erler
(1913-1967)
benannt
und
führt
in
einen
unregelmäßigen
Bogen
von
der
Georg-Neidlinger-Straße zur Hauptstraße.



Georg Neidlinger Straße
Sie
wurde
nach
dem
Weinheimer
Gönner
und
Stifter
Georg
Neidlinger
(1839,1920),
der so genannte „Hamburger Onkel“, benannt.


Großer Spitzenberg
Diese Straße wurde nach einer kleinen Anhöhe benannt, welche die Rathausstraße mit der Straße „Am Sybillenstein“ verbindet.
Das historische Straßenbild wird hier von allem von den Hausnummern 5 und 26 geprägt.
Großer Spitzenberg 5
Das
Haus
wurde
laut
Portalbeschriftung
1898
für
Georg
Neidlinger
handelt
sich
hierbei
um
ein
typisch
rheinhessisches
Gehöft
der
Jahrhundertwende
mit
traufständigem
Wohnhaus,
mächtigem
Putzbau,
einem
Giebel
mit
Zierfachwerk,
und
einem
neugotischen
Torbogen
für
Fußgänger
sowie
einem
zurückversetztem
Wirtschaftstor für Fuhrwerke. Beide Tore sind erhalten.


Großer Spitzenberg 26
Das
Gehöft
wurde
in
einer
platzartigen
Erweiterung
der
Straße
um
die
Jahrhundertwende
errichtet.
Es
ist
ein
klassizistisches
Wohnhaus
mit
Kniestock
und
Satteldach
Trauflage.



Offenheimer Straße 2
Das
Brunnenhäuschen
des
Wasserwerkes
Weinheim
wurde
1909
mit
von
Georg
Neidlinger gestifteten Mitteln erbaut.
Das
Erdgeschoss
ist
mit
Natursteingliederung
versehen,
die
sich
in
der
Umzäunung
und im Laufbrunnen fortsetzen.
Es
handelt
sich
hier
um
ein
Wasserbau-
und
heimatgeschichtlich
interessantes
Zeugnis.


Rathausstraße
Neben dem namengebenden Schul- und Gemeindehaus prägen noch die im barocken Stil errichteten Anwesen Nr. 5 und Nr. 23 das historische Straßenbild.
Rathausstraße 5
Ein
barocker
Gehöftbau
mit
der
Portal-
Beschriftung
„17
CF
59“,
der
im
19
Jhd.
einheitlich
im
Stil
der
Zeit
überformt
wurde,
jedoch
in
der
wesentlichen
Anlage
erhalten
geblieben
ist.
Es
handelt
sich
um
einen
typisch
rheinhessischen
Portalbau
mit
Fußgänger-Eingang
und
großem,
mit
Satteldach
überdachtem
Wirtschaftstor.



Rathausstraße 23
Ein
barockes
Wohnhaus
mit
der
Jahreszahl-Beschriftung
„1766“, welches im
wesentliche erhalten geblieben ist.


Rathausstraße 34
Das
heutige
Schul-
und
Rathaus
besitzt
einen
von
der
Straße
durch
einen
großzügigen
Hof
abgesetzten
zweiteiligen
Bau
mit
der
Inschrift:
„18 Schul & Gemeindehaus 87“.
Die alten Portale sind noch erhalten.


St. Gallus Ring
Diese
Straße
wurde
nach
der
katholischen
Pfarrkirche
benannt
und
verbindet
die
Rathausstraße
mit
der
Straße
„Am
Kapellenberg“.
Das
historische
Straßenbild
wird
geprägt
von
den
Anwesen
Nr.
15
und Nr. 21.



Steinbachstraße
Sie
verbindet
die
Straße
„St.-Gallus-Ring“
mit
der
Hauptstraße.
Von
der
historischen
Bebauung
der
Straße,
wahrscheinlich
bis
ins
Mittelalter
zurückreicht,
ist
heute
nur
noch
Nr.
37
erwähnenswert.
Hierbei
handelt
es
sich im
Kern um ein mittelalterliches Fachwerkhaus, welches Ende des 19. Jhd. neobarockisierend erneuert
wurde.


Flurdenkmäler
Weinheim
besitzt
einige
der
wichtigen
rheinhessischen
Weinbergarchitekturen
mit
Terrassenanlagen
wie
„Am
Sybillenstein“,
das
an
einem
Steinbruch
gelegen
war
und
die
Wingertbauten
„Auf
dem
Heiligenblutberg“.
Dieser
Weinberg
trägt
seinen
Namen
nach
einer
Sage,
der
zur
Folge
die
Hunnen
in
frühchristlicher
Zeit
viele
Christen
grausam
niedergemetzelt
haben
sollen.
Hier steht auch die Kapelle „Zum Heiligen Blut“ in idyllischer Lage mit hervorragender Fernsicht.
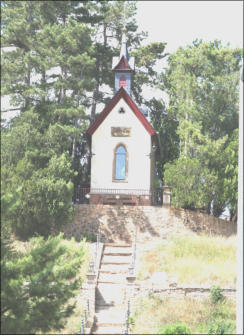

Bevor
es
zu
einer
dauerhaften
Besiedlung
auf
Weinheimer
Boden
kam,
zogen
bereits
hunderttausende
Jahre
lang
nichtsesshafte
Jäger-
und
Sammler
auf
der
Jagd
nach
Wild
durch
unsere
Heimat.
Nach
Ende
der
letzten
Eiszeit
siedelten
sich
gegen
5500
vor
unserer
Zeitrechnung
Einwanderer
an,
die
die
Errungenschaften
des
Ackerbaus
und
der
Viehwirtschaft
aus
ihrer
eurasischen
Heimat
mitbrachten.
Wie
Funde
an
der
Neumühle,
hinter
der
Raiffeisenhalle
und
der
Trift
nahelegen,
errichten
sie
hier
ihre
Häuser
und
kultivierten
bei
uns
erstmals
die
fruchtbaren
Weinheimer
Böden.Weitere
Funde
aus
den
verschiedenen
Perioden
des
Neolithikums
(Jungsteinzeit)
und
der
Bronzezeit
lassen
auf
eine
kontinuierliche
Besiedlung
auf
Weinheimer
Boden
schließen.
In
der
Laten`ezeit
von
450
vor
Christus
siedelte
das
Volk
der
Kelten
im
Alzeyer
Raum.
Die
Kelten
waren
Meister
der
Eisenbearbeitung
und
des
Kunsthandwerks.
Etwa
im
Jahre
80
v.
Chr.
verloren
die
Kelten
ihre
Siedlungsgebiete
durch
das
Vordringen
germanischer
Stämme.
Diese
wurden
wiederum
durch
die
Eroberung
Galliens
durch
Cäsar
zurückgedrängt
und
die
Grenze
des
Römischen
Reiches
wurde
in
den
Jahren
53
und
51
v.
Chr.
bis
an
den
Rhein
vorgeschoben.
Die
römische
Herrschaft
in
unserem
Gebiet
dauerte
fast
500
Jahre,
was
eine
Romanisierung
der
einheimischen
Bevölkerung
mit
sich
brachte.
Das
rheinhessische
Gebiet
wurde
bereits
zu
dieser
Zeit
stark
landwirtschaftlich
genutzt.
Die
Erträge
dienten
vor
allem
der
Versorgung
der
Garnisionslager
in
Mainz,
Worms
und
Bingen.
Unter
der
Herrschaft
Trajans
98
bis
117
erlebte
die
Region
um
Alzey
eine
wirtschaftliche
und
kulturelle
Blütezeit.
Zahlreiche
Landgüter
(Villa
rustica)
entstanden.
Bereits
Mitte
des
4.
Jahrhunderts
fielen
die
Alamannen,
später
auch
die
Burgunder
in
linksrheinisches
Gebiet
ein.
Um
das
Jahr
455
endete
schließlich
die
Herrschaft
der
Römer
durch
den
Einfall
alemannischer
und
fränkischer
Truppen,
die
auch
unser
Gebiet
eroberten.Der
fränkischen
Einverleibung
Rheinhessens
folgte
schon
bald
eine
ausgedehnte
Siedlungstätigkeit,
die
sich
in
der
Anlage
vieler
neuer
Siedlungen
und
Höfe
niederschlug,
aus
denen
im
Laufe
des
Mittelalters
die
meisten
der
heutigen
Dörfer
hervorgingen.
Bereits
bestehende
Hofstellen
wurden mitunter weiterhin benutzt. Wer im Lande verblieb, geriet in Abhängigkeit oder hatte sich in irgendeiner Weise mit den neuen Machthabern zu arrangieren.
Durch
die
Häufigkeit
des
Ortsnamens
„Weinheim“
ist
eine
erste
Nennung
des
Ortes
Weinheim
bei
Alzey
nicht
mit
voller
Sicherheit
zu
bestimmen.
Zur
Zeit
Karl
Martells
(714-741)
und
Karl
des
Großen
(768-814)
gehörte
die
Gegend
in
und
um
Weinheim
zum
Reichsgut,
während
in
9.
und
10.
Jhd.
Die
Salier
den
Weinheimer
Fronhof
(lat.
für
„Villa“)
besaßen.
Selbiger
wurde
im
12.
Jhd.
staufischer
Besitztum.In
mittelalterlichen
Zeiten
war
die
auf
dem
Windberg
zu
Weinheim
gelegene
Burg
Winnenberg.
Diese
Burg,
die
den
Herren
von
Bolanden
gehörte,
wurde
wahrscheinlich
um
1118-1198
von
Werner
II.
von
Bolanden
erbaut,
jedoch
wahrscheinlich
im
Krieg
um
1468/1470
zerstört.Während
Weinheim
seit
ca.
1.000
n.Chr.
zum
Herrschaftsgebiet
Alzey
gehörte,
übernahm
der
Reichsministeriale
Werner
II.
von
Bolanden
1194-1198
die
Herrschaft
über
Weinheim
vom
Grafen
Leiningen
als
Lehen.Die
Existenz
eines
Niedergerichtes
aus
dem
13.
Jhd.
erklärt
sich
durch
die
Tatsache,
dass
Weinheim
zu
jener
Zeit
ganz
oder
teilweise
unter
königlicher
Herrschaft
stand.
Dieses
Niedergericht
wurde
dem
Deutschhausorden
zu
Sachsenhausen
bei
Frankfurt
am
Main
vom
Ritter
Werner
von
Weinheim,
Sohn
des
Ritters
Heinrich
von
Alzey,
mit
all
seinen
Gütern,
geschenkt.War
Weinheim
seit
1269
Teil
der
Grafschaft
von
Sponheim,
fiel
es
um
1360
an
den
Grafen
von
Rieneck
und
nach
1400
an
den
Pfalzgrafen
von
Simmern. In der Zeit von 1489 bis zur napoleonischen Zeit blieb Weinheim jedoch kurpfälzisch.
Ein
so
genanntes
Pfarramt
gab
es
in
Weinheim
schon
vor
der
Reformation.
Es
diente
als
Wohnung
des
Pfarrers.
Zur
Reformationszeit
hatte
Weinheim
um
1557
einen
evangelisch-lutherischen
Pfarrer,
welche
1563
in
ein
reformiertes
Bekenntnis
und
unter
Ludwig
VI.
in
ein
lutherisches
Bekenntnis
umschwenkte.
Nach
Ende
des
30jährigen
Krieges
und
dem
anschließenden
Westfälischen
Frieden
kam
es
zu
einer
Rekatholisierung
der
gesamten
Kurpfalz.Durch
die
Zweiteilung
der
bestehenden
evangelischen
Kirche
besaß
Weinheim
zeitweise
3
Kirchen,
eine
lutherische
(eigene
Kirche
Ecke
Brennofen),
eine
reformierte
und
eine
katholische.Durch
die
Vereinigung
beider
Gemeinden
im
Jahre
1822
wurde
diese
Zweiteilung
überwunden.
Während
Weinheim
von
1653
–
1816
Filiale
von
Mauchenheim
war,
wurde
es
während
der
Franzosenzeit
1816
Filiale
von
Alzey.Seit
1824
gehört
Weinheim
nun
als
Filiale
zum
evangelischen
Pfarramt
Offenheim.Vom
19.
Jahrhundert
bis
zur
GegenwartMit
Hilfe
des
Spenders
Georg
Neidlinger
widerfuhr
Weinheim
gegen
Ende
des
19.
Jhd.
ein
Aufschwung,
den
es
aus
eigener
Kraft
nicht
hätte
entwickeln
könne.Georg
Neidlinger
hatte
bereits
im
jugendhaften
Alter
von
21
den
Vertrieb
von
Singer
–
Nähmaschinen
in
ganz
Europa
geleitet.
Mit
seiner
Spendenhilfe
wurden
zu
dieser
Zeit
zahlreiche
öffentliche,
staatliche
und
kirchliche
Projekte
realisiert.
So
zum
Beispiel
1910
die
zentrale
Hauswasserversorgung
und
die
Pflasterung
der
Dorfstraßen.Seit
der
Verwaltungsreform
gehört
Weinheim,
welches
vorher
eine
selbstständige
Gemeinde
war,
seit
1972
zur Stadt Alzey


Hier
handelt
es
sich
um
den
ehemaligen
Deutschherrenhof
Ecklage
Hauptstraße/Offenheimerstraße.
Es
handelt
sich
herbei
um
eine
Schenkung
des
Ritters
Werner
von
Weinheim
an
das
Deutschordenshaus
in
Frankfurt-Sachsenhausen
und
wurde
erstmals
1273
urkundlich
erwähnt.
Zu
dieser
Schenkung
gehören
neben
dem
Niedergericht
noch
mehrere
Mühlen
und
ein
fester
Turm.
Es
handelt
sich
hierbei
um
ein
förmlich
geschütztes
Kulturdenkmal
mit
Jahreszahlbe-schriftung
(1613
und
1754)
und
Ordenswappen.
Die
Villa
„Heiligenblut“
am
„Heiligen
Blutberg“
gelegen,
wird
von
der
Straße
her
durch
einen
großen
Vorgarten
mit
Zufahrt
abgesetzt.
Um
1887
wurde sie für den Fabrikanten und Kaufmann Georg Balz aus Hamburg errichtet.
Sie
ist
ebenfalls
symmetrisch
gegliedert.
Besonders
zu
erwähnen
ist
hier
der
rechterhand
zurückversetzte,
mit
dem
Hausverbundene,
dreigeschossige
Belvedere-Eckturm.
An
den
beiden
Hausflanken
finden
sich
klassizisierende
Bildnis-Tondi von römischer Abstammung.
Besonders
zu
erwähnen
ist
hier
die
Nummer
36,
der
Friedhof.
Die
Grundstücke
hierfür
wurden
von
Georg
Neidlinger
gestiftet,
welcher
auch
die
Leichenhalle
und
die
Umfriedung
mit
dem
dreigliedrigen
neugotischen
Torbogen
gestiftet
hat.Die
Gedenksteine
für
das
Andenken
der
im
Krieg
1870/1871
Gefallenen
sowie
für
das
Andenken
der
in
den
beiden
Weltkriegen
Gefallenen
sowie
die
einigen
wenigen
„luxuriöseren“
Grabsteinen
sind
hierbei
ebenfalls
zu
erwähnen.
Design und Websitegestaltung by Gernot Loos © 2024
Hierbei handelt sich um die ehemalige evangelische Schule in direkter Nachbar-
schaft der evangelischen Pfarrkirche. Der lang gestreckte, eineinhalbgeschossige
Putzbau ist symmetrisch gegliedert und außer den typischen Neuerungen weitge-
hend unverändert.
Dorfarchiv
Weinheim












