Historische Funde in Weinheim

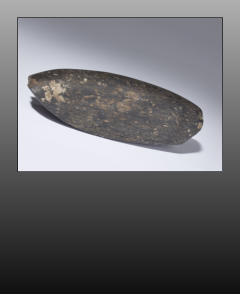
Schuhleistenkeil
Fundort Weinheim
11,3 cm Länge.
Hessisches Landesmuseum
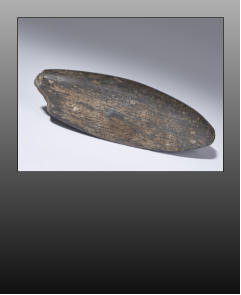
Schuhleistenkeil
Fundort Weinheim
11,3 cm Länge.
Hessisches Landesmuseum

Kleiner Schuhleistenkeil
Fundort Weinheim
7,2 cm Länge.
Hessisches Landesmuseum
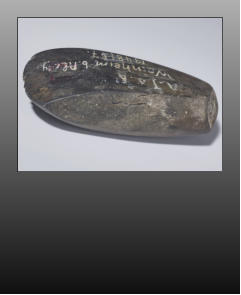
Kleiner Schuhleistenkeil
Fundort Weinheim
7,2 cm Länge.
Hessisches Landesmuseum
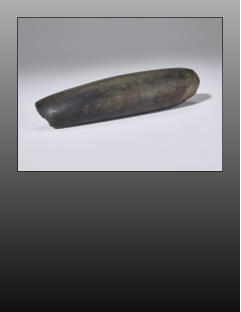
Großer Schuhleistenkeil
Fundort Weinheim
15,0 cm Länge.
Hessisches Landesmuseum

Großer Schuhleistenkeil
Fundort Weinheim
15,0 cm Länge.
Hessisches Landesmuseum
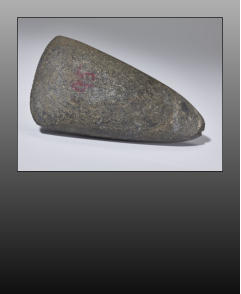
Felsgesteinbeil
Fundort Weinheim
Hessisches Landesmuseum
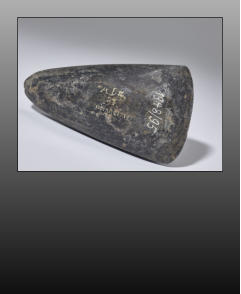
Felsgesteinbeil
Fundort Weinheim
Hessisches Landesmuseum
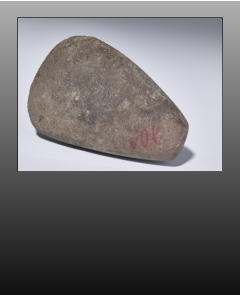
Felsgesteinbeil
Fundort Weinheim
8,3 cm Länge
Hessisches Landesmuseum
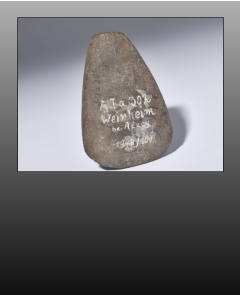
Felsgesteinbeil
Fundort Weinheim
8,3 cm Länge
Hessisches Landesmuseum

Felsgesteinaxt
Fundort Weinheim
7,2 cm Länge
Hessisches Landesmuseum
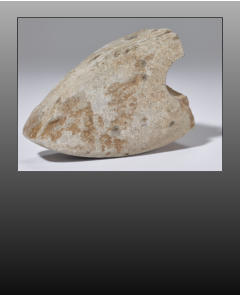
Felsgesteinaxt
Fundort Weinheim
7,2 cm Länge
Hessisches Landesmuseum
Bilder historischer Funde
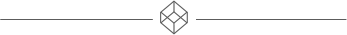
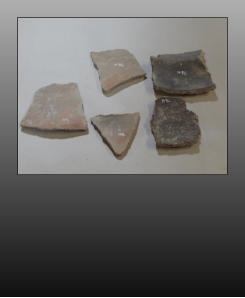
Scherben Hallstattzeit
Fundort Weinheim 1957
Siedlungsgrube
Museum Alzey
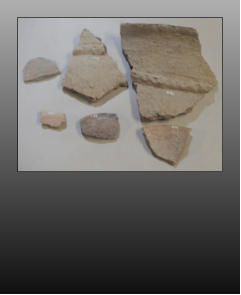
Scherben Hallstattzeit
Fundort Weinheim
Museum Alzey

Scherben eines Kumpfes
Fundort Weinheim 1958
5600 - 4900 vor Christus
Museum Alzey
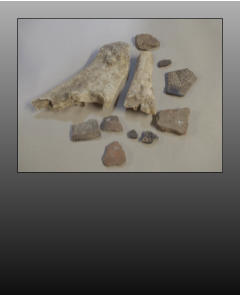
Rössener Kultur
Fundort Weinheim 1954
4500 - 4300 v. Chr.
Museum Alzey
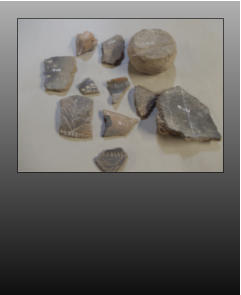
Rössener Kultur
Fundort Weinheim 1954
4500 - 4300 v. Christus
Museum Alzey

Schale Becher Tasse
Fundort Raiffeisenhalle1957
800 - 450 v. Chr.
Museum Alzey
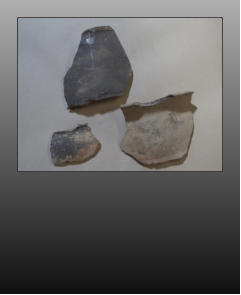
Scherben Hallstattzeit
Fundort Weinheim 1957
Museum Alzey
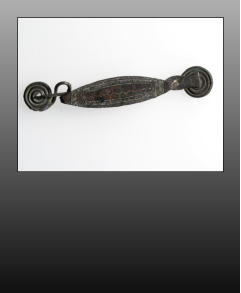
Spiralscheiben Fibel
Fundort Weinheim 1954
© GDKE Landesmuseum Mainz
Ursula Rudischer
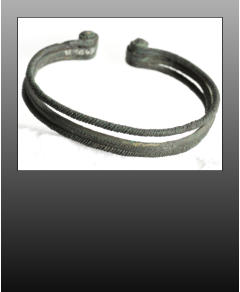
Armringe
Fundort Weinheim 1954
© GDKE Landesmuseum Mainz
Ursula Rudischer

Armring
Fundort Weinheim 1954
© GDKE Landesmuseum Mainz
Ursula Rudischer
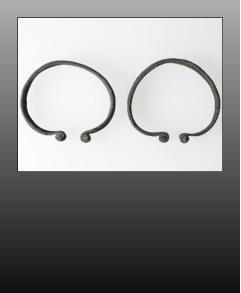
Armringe
Fundort Weinheim 1954
© GDKE Landesmuseum Mainz
Ursula Rudischer

Bombenkopfnadel
Fundort Weinheim 1954
© GDKE Landesmuseum Mainz
Ursula Rudischer

Bombenkopfnadeln
Fundort Weinheim 1954
© GDKE Landesmuseum Mainz
Ursula Rudischer

Bronzenadel
Fundort Weinheim 1954
© GDKE Landesmuseum Mainz
Ursula Rudischer

Steindechsel
Fundort Weinheim
Neolithikum
Hessisches Landesmuseum
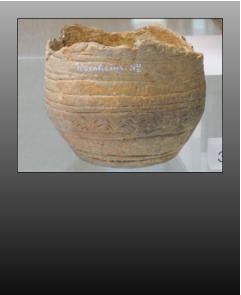
Glockenbecher Kultur
Fundort Weinheim 1926
2600 - 2200 v. Chr.
Museum Alzey
Die ersten Weinheimer Bauern
In der Nacheiszeit erfolgte eine deutliche Erwärmung zu Beginn des Mesolithikums (Mittelsteinzeit = 9640 -5500 v. Chr). Dadurch konnte sich in Mitteleuropa eine
flächendeckende Bewaldung mit einem Wildvorkommen (Rotwild, Schwarzwild, Rehwild, Wildrinder) entwickeln, das sich im wesentlichen bis heute erhalten hat.
Während sich die mesolithischen Jäger- und Sammlergruppen bei uns ausbreiteten, entstand bereits zwischen 10400 und 8200 vor Christus im Bereich des
sogenannten „Fruchtbaren Halbmondes“, in einem Gebiet das vom Oberlauf des Tigris bis nach Palästina im Südwesten und vom Fuß der türkisch-iranischen
Gebirgskette nach Südosten bis an den Persischen Gold reichte, eine der wichtigsten Umbrüche in der Geschichte der Menschheit.
Diese Periode, als neolithische Revolution bezeichnet, war in Wirklichkeit ein sich über Jahrtausende hinziehender evolutionärer Prozess. Nach und nach entstand
dort aufgrund des reichen Vorkommens an Wildgetreide der Übergang vom nomadisiertem Wildbeutertum zur planmäßigen produzierenden bäuerlichen
Wirtschaftsweise, die dadurch bedingt mit einer Sesshaftigkeit der Menschen einher ging. Im Laufe der Zeit bildeten sich vor allem im Südosten Anatoliens
größere Siedlungsgemeinschaften heraus. Die Bevölkerung wuchs und schließlich war man gezwungen neue Ackerflächen zu erschließen. Vom südöstlichen
Europa aus erfolgte in erstaunlich kurzer Zeit eine Neolithisierung Mitteleuropas über den Balkan und das Karpatenbecken und über die sich schließlich im
westlichen Ungarn entwickelnde bandkeramische bzw. linienbandkeramische Kultur. Entlang der großen Flusssysteme wandern die Bauern in Richtung Westen
und erreichten Mitte des 6. Jahrhunderts aus dem Maintal kommend Rheinhessen. Die Bauern brachten ihre Kulturpflanzen (Einkorn, Emmer, Gerste, Erbse und
Linse ) und selbst ihre Nutztiere (Rinder, Schafe, Ziegen) -als „neolitisches Paket“ bezeichnet- aus ihrer ursprünglichen Heimat mit, und begannen auch auf dem
Gebiet der heutige Weinheimer Gemarkung Landwirtschaft zu betreiben. Sie fanden hier geradezu ideale Bedingen vor. Während in anderen Regionen erst
mühsam Rodungen vorgenommen werden mussten, war bereits zur damaligen Zeit in Rheinhessen eine vergleichsweise geringe Bewaldung vorhanden.
Gleichzeitig waren die aus der nacheiszeitlich entstandenen lössgebundenen Braun- und Schwarzerden ausgesprochen fruchtbar und leicht zu bearbeiten.
Die ansässigen Wildbeutergemeinschaften stellten für die eingewanderten Bauern keine Konkurrenz dar, weil diese keinen Anlass sahen ihre bewährte
Lebensweise aufzugeben. Sie wichen vielmehr in Gebiete aus, in denen es genug Wild zu bejagen gab. Gleichzeitig führten sie mit den zugewanderten Bauern
weitgehend eine friedliche Koexistenz, trieben Handel und sehr vereinzelt heirateten Jäger-Sammler-Frauen auch in die Bauerngesellschaften ein. Spätestens
3000 v. Chr. hatten sich die letzten Jäger und Sammler überall an die neue Lebensweise angepasst, waren assimiliert oder hatten sich in Bereiche zurückgezogen,
die für den Ackerbau ungeeignet waren.
Die Zusammenschau mit Funden aus den benachbarten Gemeinden, hier insbesondere aus Dautenheim und Flomborn macht es wahrscheinlich, dass es bereits
seit der Epoche der Bandkeramik eine bäuerliche Besiedlung auch auf Weinheimer Gebiet gab. So konnte in einer Siedlungsgrube im Steinbruch bei der
Neumühle Reste eines bandkeramischen Kumpfes (rundbodiges und henkelloses Gefäß mit geritzten Verzierungen) gefunden werden. Ebenfalls wurde ein
weiterer Kumpf in der Straßenböschung hinter der Raiffeisenhalle 1958 aufgelesen. Diese Funde sind in den Zeitraum zwischen 5600 und 4900 Jahre v. Chr. zu
datieren. Weitere Artefakte aus der Rössener Kultur (4500 – 4300 v. Chr.) aus Siedlungsgruben bei der Neumühle und an der Straßenböschung hinter der
Raiffeisenhalle lassen auch für diesen Zeitabschnitt eine Besiedlung Weinheims als sicher erscheinen. Funde von geschliffenen Steinwerkzeugen aus der Zeit des
Neolithikums ergänzen das Bild. Die von einwanderten Halbnomaden aus dem Osten eingeführte bzw. übernommene Glockenbecherkultur (2800 - 2200 v. Chr.)
- mit einem Fund an der Trift in einem Hockergrab - schloss sich der Weinheimer Besiedlungsgeschichte an und wurde von der nachfolgenden frühen und späten
Bronzezeit abgelöst (2200 bis 800 v. Chr.). Reiche Funde aus dieser Periode sind in den Museen Darmstadt, Wiesbaden, Mainz und Alzey ausgestellt oder in deren
Archiven deponiert.




























Folgend sehen Sie Abbildungen historischer Funde aus Weinheim.
Mit einem Klick auf das Textsymbol im Bild, erhalten Sie weitere Informationen
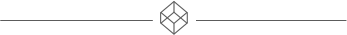
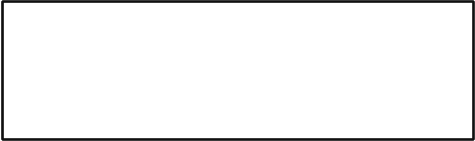
Schuhleistenkeil:

Der Schuhleistenkeil ist eine in der Archeologie
verbreitete Bezeichnung für Klingen prähistorischer
Dechseln. Sein Name leitet sich von der Form ab, die
an eine Schuhleiste erinnert. Sie bestehen aus
überschliffenem Felsgestein.
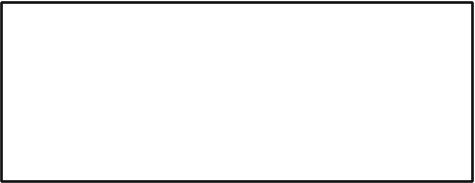
Felsgesteinbeil:
Felsgesteinbeile wurden unter anderem zum
Baumfällen eingesetzt. Wie der Name es andeutet,
wurden sie aus Felsgestein hergestellt. Dabei
bevorzugten die Menschen aus Rheinhessen einen
rötlichen bis braunen devonischen Quarzit, der häufig
in Form von Geröllen in Fluß- und Terassenschottern zu
finden ist.
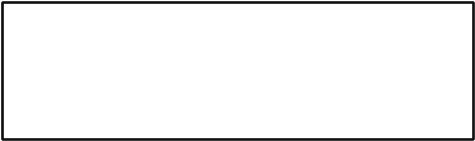
Felsgesteinaxt:
Im Gegensatz zum Beil ist die Axt in der Schäftung
schlanker und hat einen kürzeren Stiel.
Siehe auch Felsgesteinbeil.
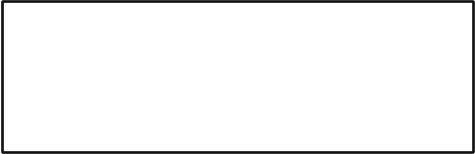
Hallstattzeit:
Als Hallstattzeit, benannt nach einem Gräberfeld in
Östereich/Salzkammergut, wird die ältere vorrömische
Eisenzeit in weiten Teilen Europas, ab etwa 800 v. Chr.
bezeichnet. In dieser Epoche lässt sich eine deutliche
Hierarchisierung der Gesellschaft feststellen.
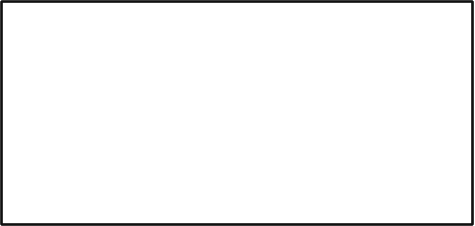
Rössenerkultur:
In dieser Periode wurden Langhäuser bis zu 85m
Länge errichtet. Durch die mehrfache Innenaufteilung
wurde nachgewiesen, dass mehrere Familien in einem
Haus wohnten. Im Gegensatz zur Bandkeramik kann
bei dieser Kulturstufe von echten Dorfanlagen
gesprochen werden. Die Siedlungen befanden sich oft
in Schwarzerdgebieten. Characteristische
Bestattungsweise war die Körperbestattung in
gestreckter Rückenlage.

Glockenbecherkultur:
Als Glockenbecher werden keramische Gefäße
mit flachem Standboden und S-förmigem Profil
bezeichnet, die meist flächendeckend verziert
sind. In diese Periode fällt eine massive
Einwanderung von Steppenvölkern aus
osteuropäischen Gebieten, die mindesten 70%
der Bevölkerung in Deutschland ersetzten.

Spiralscheiben Fibel:
Fibeln wurden benutzt, um Kleider, Umhänge
und Mäntel zusammen zu halten (Gewand
schließen). Sie lösten die Gewand- Nadel ab. Sie
dienten auch als Schmuck und waren oft zugleich
Rangabzeichen und Statussymbol.

Armringe:
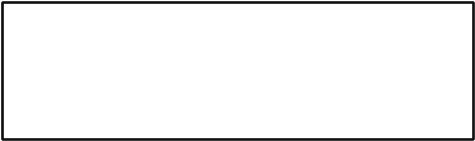
Bombenkopfnadel:
Die den Kopf der Nadel bildenden halbkugeligen
Bronzeschalen sind flach gearbeitet, sodass er
eher linsenförmig als kugelig gestaltet ist.
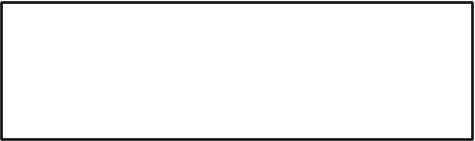
Bronzenadel:
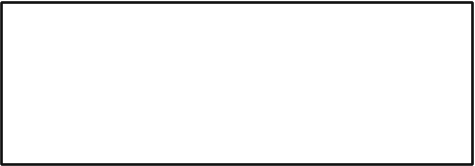
Steindechsel:
Die Dechsel ist ein Werkzeug, dass bei der
Holzbearbeitung zum Abnehmen großer Spanmengen,
wie auch zum Schlichten und Glätten dient. Es gibt das
Werkzeug mit langem Stiel für beidhändigen Schlag wie
mit einer Hacke oder mit kurzem Stiel für einhändiges
arbeiten.
Rundbodiges und henkelloses Gefäß mit geritzten Verzierungen.
Bronzenadeln wurden benutzt, um Kleider, Umhänge
und Mäntel zusammen zu halten (Gewandschließen). Sie
dienten zugleich auch als Schmuck.
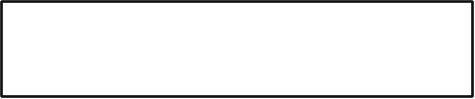
Kumpf:
Armringe aus Bronze dienten als Schmuck und wurden von
beiden Geschlechtern getragen. Nach dem Tod des Trögers
dienten sie oft als Grabbeigaben. Sie waren sicherlich nur
begüterten Bevölkerungsschichten vorbehalten und somit
auch als Statussymbol.
Design und Websitegestaltung by Gernot Loos © 2024
Dorfarchiv
Weinheim












