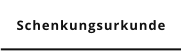Der Wohltäter
Georg Neidlinger
Eine außergewöhnliche und ambivalente
Unternehmerpersönlichkeit
Georg Neidlinger

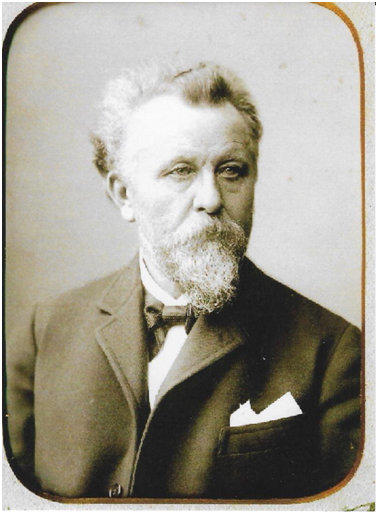
Von Georg Stappert
Aufnahmen von Hans Jürgen Loos und Adolf WeberDer Unternehmer
Wenn
in
Weinheim
der
Name
Georg
Neidlinger
fällt,
dann
fangen
vor
allem
viele
ältere
Bürger
sogleich
an,
von
den
Wohltaten
des
“Hamburger
Onkels“
zu
erzählen.
So
erinnern
noch
heute
insbesondere
das
Georg-Neidlinger-Haus,
die
Georg-Neidlinger-Straße
und
das
Georg-Neidlinger-Denkmal
an
diese
außergewöhnliche
Unternehmerpersönlichkeit, der Weinheim viel zu verdanken hat.
Wer war nun dieser große Wohltäter unserer Heimatgemeinde?
Georg Neidlinger wurde am 12. Mai 1839 als Sohn des Landwirts Johann Adam Neidlinger (1790-1881) und seiner Ehefrau Maria Magdalena geb. Maschmann hier in Weinheim geboren. Aus der Ehe gingen zwölf Kinder hervor, von denen fünf Söhne und drei Töchter das Erwachsenenalter erreichten. Als politisch engagierte Befürworter des Gedankenguts der 1848er-Revolution mussten seine wenige Jahre älteren Brüder Adam und Johannes nach Amerika auswandern, um der Verhaftung oder Bestrafung zu entgehen. Adam, der Begründer einer Brauerei, und Johannes als Farmer waren recht bald erfolgreich und ermunterten die Geschwister ebenfalls, ihr Glück in der „Neuen Welt“ zu suchen. 1855 folgte deshalb der 16jährige Georg der Einladung seiner Brüder und wagte mit einem Segelschiff die Überfahrt nach Amerika. Noch kurz vor seiner Ankunft soll er von Piraten überfallen worden sein, so dass er ohne Hab und Gut an Land ging. Einige Zeit arbeitete Georg zunächst in verschiedenen Branchen, bis er schließlich am 26. November 1857 eine feste Anstellung bei der „SINGER MANUFACTORY COMPANY“ in New York fand. Diese Firma war 1851 von Isaac Merrit Singer gegründet worden und stellte die ersten Nähmaschinen fabrikmäßig her. Auch der Ratenverkauf war schon eine Erfindung Singers. Der junge Georg Neidlinger, technisch außerordentlich versiert, stieg nun sehr schnell vom Packer in die Führungsebene des Unternehmens auf. Bereits 1860 wurde er mit dem Auftrag nach Hamburg geschickt, dort eine Werkstatt und eine Verkaufsniederlassung einzurichten. Zunächst gründete Neidlinger die eigenständige Firma „Singer Generalvertretung Georg Neidlinger“ und begann sogleich mit aggressiven Verkaufsstrategien die Singer-Nähmaschinen europaweit an den Mann zu bringen. Bereits um 1875 besaß er mit 214 Filialen das dichteste Singer-Filialnetz in Europa, das damals über 100.000 Nähmaschinen jährlich verkaufte. Sein Bestreben um weitere Expansion wird auch dadurch deutlich, dass Georg Neidlinger 1885 an der Admiralitätsstraße ein Geschäftshaus errichten ließ, das als Kontor und Lager für seinen Nähmaschinenbetrieb diente und bis heute seinen Namen trägt, das sogenannte Neidlingerhaus.“


Georg Neidlinger Haus Hamburg
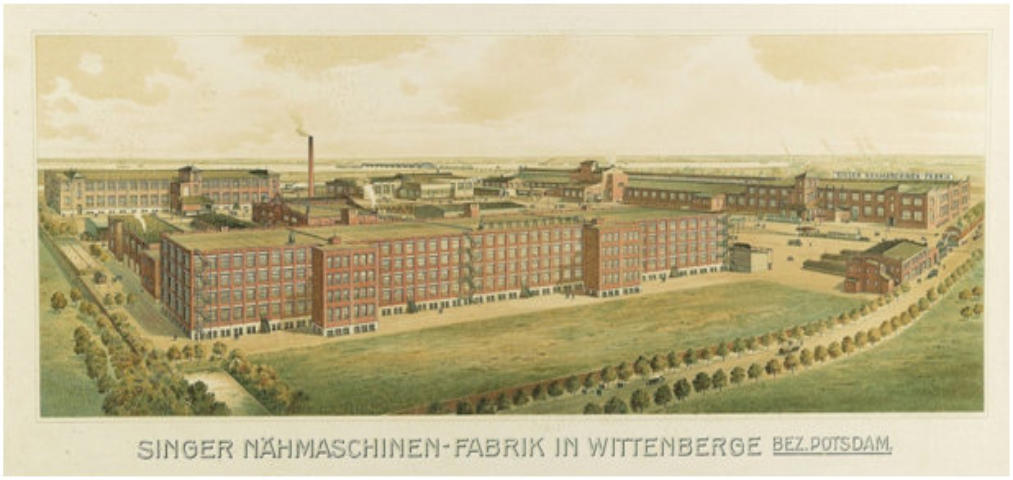
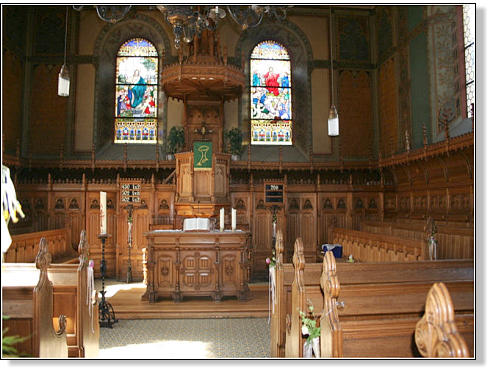
Evangelische Kirche Weinheim

Eingangstor Friedhof in Weinheim

Wasser-Pumpwerk Weinheim
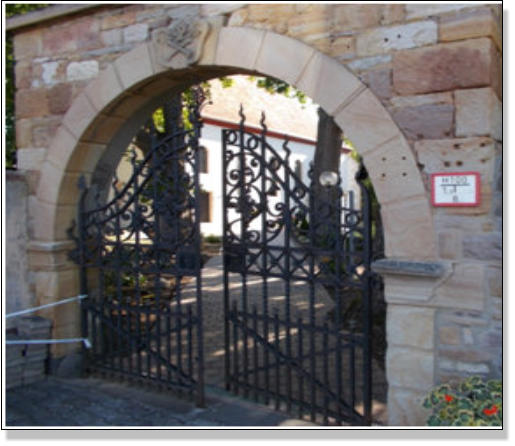
Eingangstor zur katholischen Kirche Weinheim

Grabstätte für Eltern und Geschwister auf dem Friedhof Weinheim
Georg Neidlinger Haus Weinheim

Gedenkstein Georg Neidlinger Weinheim



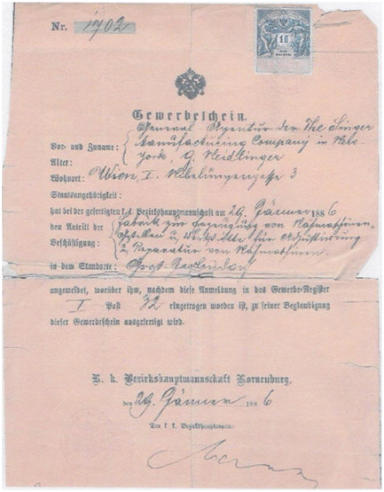
Wohnhaus der Familie Gysler
ehemals Geburtshaus von Georg Neidlinger
Abdeckplatte der Wasserquelle im
Keller des Weingutes Gysler
Elisabeth Neidlinger geb. Gamlin
Ehefrau von Georg Neidlinger
Gewerbeschein von 1886
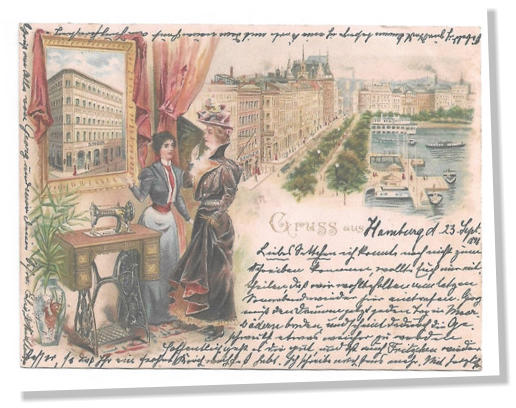
Textauszug Gedenktafel:
Georg Neidlinger 1839 - 1920
Stiftungen:
1892
Erneuerung der evangelischen Kirche
1892
Hochaltar der Katholischen Kirche Umfassungsmauern und Schmiedeeisernes Tor
1907
Friedhof – Einfriedungsmauer Leichenhalle
1910
Bau einer Wasserleitung, Pflasterung der Dorfstraßen
1912
Elektrizitätsversorgung
1920
Einrichtung der evangelischen Kinderschule und Schwesternwohnung
Galerie:
Eine Postkarte von Georg Neidlingers Frau

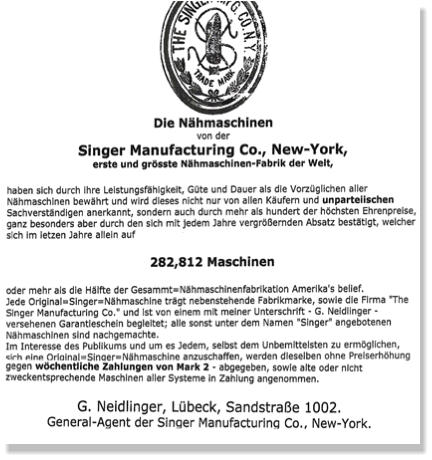
Eine Postkarte von Georg Neidlingers Frau
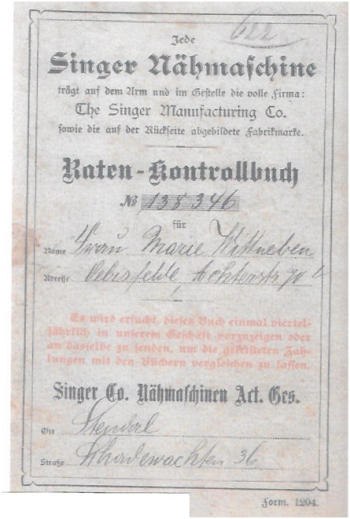
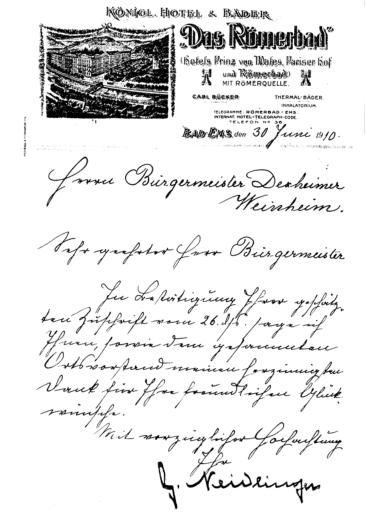
Raten-Kontrollbuch 28.01.1907
für Frau Maria Wittneben
In Oebisfelde, Achterstraße 70
Ein Dankeschön von Georg Neidlinger
„Es wird ersucht dieses Buch
einmal vierteljährlich in
unserem Geschäft
vorzuzeigen oder an dasselbe
zu senden, um die geleisteten
Zahlungen mit den Büchern
vergleichen zu können.“
Bad Ems, den 30. Juni 1910
Herrn Bürgermeister Dexheimer Weinheim
Sehr geehrter Herr Bürgermeister
In Bestätigung Ihrer geschätzten Zuschrift vom 26. dieses
Jahres sage ich Ihnen, sowie dem gesamten Ortsvorstand
meinen herzinnigsten Dank für Ihre freundlichen Glückwünsche.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr G. Neidlinger
Auch
mit
verschiedenen
Zeitungen
legte
er
sich
an,
weil
sie
darüber
berichteten,
dass
Singer-Nähmaschinen
im
Vergleich
zu
deutschen
Produkten
schlechter
abschnitten.
Die
meisten
Prozesse
verlor
Neidlinger,
doch
seine
aggressive
Umtriebigkeit
ging
weiter.
So
führte
er
schon
recht
früh,
die
von
Singer
bereits
in
den
USA
erprobten
Ratenzahlungen
ein,
oder
er
kaufte
seine
gebrauchten
im
Wettbewerb
mit
deutschen
Produkten
schlechter
abgeschnittenen
Singer-Nähmaschinen
für
rund
10
Mark
auf,
ergänzte
sie
durch
geringfügige
Verbesserungen
und
verkaufte
sie
wiederum
zum
Originalverkaufspreis.
Auch
bot
er
einer
Berliner
Zeitung
hohe
finanzielle
Mittel
an,
um
die
Veröffentlichung
und
Beschwerden
der
deutsche
Nähmaschinenfabrikanten
zu
verhindern,
die
ihm
darin
unlautere
Machenschaften unterstellten.
Nicht
weniger
freundlich
war
der
Umgang
Neidlingers
mit
seinen
Firmenuntergebenen.
So
befahl
er
u.a.
jedem
seiner
Vertreter,
einmal
jährlich
die
Haushalte
seines
Einzugbereiches
mit
Werbematerial
zu
besuchen
und
darüber
nach
Hamburg
zu
berichten.
„Der
dafür
gezahlte
Lohn
war
gering
und
musste
durch
die
versprochene
Provision
aufgebessert
werden.
Diese
war
allerdings
erst
fällig,
wenn
die
bestellte
Nähmaschine
ganz
bezahlt
war.
Blieb
aber
eine
Rate
aus
oder
der
Schuldner
wurde
zahlungsunfähig,
dann
verfiel
auch
die
Provision.“
Zudem
musste
jeder
Vertreter
bei
seiner
Anstellung
1000
Mark
Kaution
hinterlegen,
die
allerdings
verfiel,
wenn er kündigte oder sich um eine Anstellung bei einer anderen Nähmaschinenfirma bewarb.
Aus
all
diesen
Geschäftsgebahren
wird
ersichtlich,
dass
Georg
Neidlinger
in
den
Anfangsjahren
von
„Singer“
in
Europa
unersetzlich
war.
Denn
ihr
Protagonist
war
nicht
nur
ein
umtriebiger
Kaufmann
und
Organisator
sondern
auch
ein
begnadeter
Techniker,
der
die
ständige
Weiterentwicklung
seiner
„Singer-
Nähmaschinen“
vorantrieb und sich allein 40 Verbesserungen patentieren ließ.
Ohne
Neidlinger
hätte
Singer
auch
nicht
diesen
außerordentlichen
Bekanntheitsgrad
in
Europa
erreicht.
Als
1895
mit
der
Gründung
der
„Singer
Nähmaschinen
AG“
in
Hamburg
Neidlingers
Firma
in
eine
Aktiengesellschaft
umgewandelt
wurde,
trat
er
in
deren
Vorstand
ein.
Neidlingers
Alleinherrschaft
ging
damit
zu
Ende.
Aber
als
Aktionär war er nunmehr, ohne seine bisherigen 25jährigen Einkünfte, um weitere fünf Millionen Mark reicher geworden.
Seine
geschäftliche
Umtriebigkeit
ging
aber
damit
nicht
zu
Ende.
So
kaufte
er
1902
im
Auftrag
der
„Singer
AG“
für
32000
Mark
in
Wittenberge
an
der
Elbe
ein
fast
fünf
Hektar
großes
Gelände,
auf
dem
ein
Jahr
später
die
Singernähmaschinenfabrik
entstand.
Sie
wurde
allmählich
zur
einzigen,
größten
und
leistungsfähigsten
Produktionsstätte
in
Deutschland
ausgebaut.
Sie
überdauerte
später
beide
Weltkriege
und
wurde
zu
DDR-Zeiten
unter
dem
Firmennamen
„Veritas“
weitergeführt,
um dann unter neuen „marktwirtschaftlichen“ Bedingungen abgewickelt zu werden.
So
ist
es
„eine
makabere
Ironie
des
Schicksals,
dass
sowohl
der
Initiator
für
den
Nähmaschinenstandort
Wittenberge
als
auch
sein
Liquidator
von
1992
aus
Hamburg kam.“
Literaturhinweise:
Julius Grünewald, Die Familie Neidlinger und der „Hamburger Onkel“, in: Heimatjahrbuch 1989, S. 91-97
Karl Müller, Geschichte und Kirchengeschichte von Weinheim bei Alzey, 1975, S. 69 -72
Laudatio auf Georg Neidlinger anlässlich des Festgottesdienstes am 03.08. 1992: „100 Jahre Kirchenrenovierung“
Festschrift „100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Weinheim 1892-1992, S.55-59
Artikel aus der AZ: „Er tat viel für Weinheim“ (Zeugenaussagen)
Originalbriefe von Georg Neidlinger
Veritaslounge... the official website of veritas: „Der Initiator der Wittenberger Nähmaschinenfabrik“
Die Begründer der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung, www.hmb-wiss-stift.de/home/donatoren
Jubiläum der St. Galluskirche Weinheim 1481-1981
Ur.-Nr.10473: Schenkung an die Gemeinde Weinheim vom 23.12.1907
Ur.-Nr.269: Aufstellung der Kosten für den Bau der Wasserleitung der Gemeinde Weinheim vom 12.12.1912
Schreiben des Bürgermeisters Dexheimer „An das Grossherzogliche Ministerium der Justiz in Darmstadt“ um Rückvergütung des Stempelbetrags vom 21.02.1908
Schreiben
des
Generalstaatsanwalts
vom
11.07.1908
wegen
eines
„Gesuchs
des
Kaufmanns
G.
Neidlinger
zu
Hamburg
um
Erstattung
des
Stempels
für
eine
Schenkung an die Gemeinde Weinheim“
Hamburger Adressbücher
Raten-Kontrollbuch von 1907
Gewerbeschein von 1886
Dankschreiben von Georg Neidlinger
Man muss wissen, dass Bad Ems vor dem 1. Weltkrieg als „Weltbad“ und Sommerresidenz des europäischen Hochadels seine ganz große Glanzzeit erlebte.
So weilten hier u.a. Kaiser Wilhelm I., die Zaren Nikolaus I. und Alexander II. sowie der gesamte europäische Hochadel und nicht zuletzt berühmte Musiker und
Schriftsteller wie Richard Wagner oder Fjodor Michailowitsch Dostojewski.
Ob Georg Neidlinger ihnen begegnet ist?
Diese Postkarte ist an Georg Neidlingers jüngste Schwester Elisabeth (1842 – 1922) gerichtet, die mit einem Johann Balz (1837 – 1907) verheiratet war. Das Ehepaar
hatte den Hof der Neidlinger-Eltern (das heutige Anwesen des Weingutes Gysler) übernommen.
Geschrieben hat die Postkarte Georg Neidlingers Frau. Sie hieß Elisabeth Gamlin und war eine Londoner Bankierstochter.
Manches auf der Karte ist schwer zu entziffern. Vielleicht lag es daran, dass Frau Neidlinger als Engländerin die Sütterlin-Schrift nicht so gut beherrschte.
Gruß aus Hamburg d. 23. Sep. 1898
Liebes Settchen (?)
ich konnte noch nicht zum Schreiben kommen, wollte Euch mitteilen, daß wir wohlbehalten am letzten
Sonnabend (?) wieder hier eintrafen. Georg muss den Daumen jetzt jeden Tag in Moorbädern baden
und scheint dadurch die Geschwuls (?) (t)etwas weicher zu werden. Hoffentlich geht es dir gut
und ist (?) auch Fritzchen wieder besser, so daß Ihr ein großes (?) Brief (?)
__________________ _________________ habt. Ich schreibe euch
(?) _______________ mehr. Sobald ich zum Markt (?) komme besorge ich eine Karte
(?) mit dem neuen Haus am Jungferstieg.
Mit herzlichem Gruß an Alle von Georg und mir .
Deine Schw(ägerin) Elis(abeth) Neidlinger
Der Wohltäter
Der
große
Reichtum
Neidlingers
ermöglichte
es
ihm,
sich
auch
immer
stärker
am
gesellschaftlichen
Leben
in
Hamburg
zu
beteiligen.
Äußerer
Ausdruck
seines
Reichtums
war
u.a.
das
fünfgeschossige
Gebäude
am
Jungfernstieg
/
Alsterarkaden
und
seine
im
italienischen
Neo-Renaissance-Stil
erbaute
Villa
in
Hamburg-
Uhlenhorst,
die
er
mit
seiner
Gattin
Elisabeth
geb.
Gamlin,
einer
Londoner
Bankierstochter,
bewohnte.
Dass
die
Ehe
kinderlos
blieb,
ist
vielleicht
mit
ein
Grund,
dass
sich Georg Neidlinger sowohl in Hamburg als auch in seiner Heimatgemeinde Weinheim als überaus großzügiger Donator und Wohltäter betätigte.
So
zählte
er
in
Hamburg
zu
den
finanziell
am
stärksten
engagierten
Gründungsaktionären
des
Deutschen
Schauspielhauses,
das
1900
eröffnet
wurde.
Georg
Neidlinger
war
auch
1907
mit
etwa
20.000
Mark
einer
von
46
Donatoren
der
„Hamburgischen
Wissenschaftlichen
Gesellschaft“,
die
1919
zur
Gründung
der
dortigen
Universität führte. Im Foyer des Hauptgebäudes der Universität ist noch heute sein Name verzeichnet.
In
noch
viel
größerem
Maße
jedoch
bedachte
er
seine
Familienangehörigen
und
seine
Heimatgemeinde
Weinheim.
„So
ist
es
bezeichnend
für
seinen
edlen
Charakter,
dass
er
im
Jahre
1888,
als
er
die
ersten
Früchte
seiner
regen
Tätigkeit
zu
ernten
begann,
den
Armen
der
Heimat
gedachte
und
ein
Kapital
von
8000
Mark
stiftete, dessen Zinsen acht armen, alten, hilfsbedürftigen Personen zu Gute kommen sollen.“ (Dokument des Gemeinderats, 1920).
1891/92
stellte
Georg
Neidlinger
für
die
Renovierung
der
evangelischen
Kirche
52309,38
Goldmark
aus
seinem
Privatvermögen
zur
Verfügung.
Das
Werk
war
so
gut
gelungen,
dass
die
Chronik
vermerkte,
die
Kirche
sei
„zu
einem
herrlichen
Kunstwerk
im
edelsten
Sinne
des
Wortes
-
zu
einem
Werke
aus
einem
Guß
-
umgeschaffen
worden.“
Im
Jahre
1899
schenkte
er
der
Ortsgemeinde
48000
Mark
für
das
schmiedeeiserne
Tor
und
die
Einfriedungsmauer
des
neuen
erweiterten
Friedhofs.
Zu
Beginn
des
neuen
Jahrhunderts
,
im
Jahre
1902,
wurden
die
Ortsstraßen
auf
seine
Kosten
gepflastert.
Und
da
Weinheim
seit
Jahrzehnten
unter
Wassermangel
litt,
schenkte
er
der
bürgerlichen
Gemeinde
1907,
ein
Tag
vor
Heiligabend,
für
die
Herstellung
der
Wasserleitung
„zum
freien
unwiderruflichen
Eigentum“
eine
„zu
verausgabende
Summe
bis
zu
einem
Höchstbetrag
von
36.000
Mark
.“
(Urk.Nr.10473).
Auch
die
vom
Großherzoglichen
Ministerium
der
Justiz
erlassenen
Schenkungssteuer
(„Stempelerlaß“)
in
Höhe
von
1098,42
überlässt
Neidlinger
der
Gemeinde.
Durch
eine
weitere
Spende
erhielt
die
evangelische
Kirche
1907
einen
neuen Ofen und 1912 elektrisches Licht. Ebenfalls im Jahr 1907 ließ er auf dem Friedhof eine Leichenhalle errichten.
Eine
sehr
lobenswerte
und
weitsichtige
Entscheidung
Neidlingers
kann
man
auch
aus
einem
Briefwechsel
mit
der
Ortsgemeinde
Weinheim
entnehmen.
Hier
teilte
er
mit,
dass
er
am
06.
Dezember
1909
seine
Vollmacht
über
Herrn
Notar
Jost
an
Bürgermeister
Dexheimer
hat
übertragen
lassen
und
zwar
„zum
Ankauf
der
Grundstücke für einen Kinderspielplatz..., sodass bei der Unterzeichnung der Akten auch die Zahlungen sofort geleistet werden können.“
(s. Brief v. 08.12. 1909)
Als
dann
auch
noch
die
Straße
zwischen
Weinheim
und
Mauchenheim
ausgebaut
wurde,
erhielt
die
Gemeinde
von
ihrem
Wohltäter
im
Mai
1913
noch
einmal
2000
Mark.
Wenige
Jahre
vorher
muss
wohl
auch
Großherzog
Ernst
Ludwig
von
der
großen
Spendenfreudigkeit
Neidlingers
erfahren
haben,
weshalb
er
ihn
1910
mit
dem
Ritterkreuz erster Klasse auszeichnete.
Außergewöhnlich
sind
auch
die
finanziellen
Zuwendungen
an
die
katholische
Kirchengemeinde.
Gerade
in
einer
Zeit,
in
der
das
Verhältnis
zwischen
Katholiken
und
Protestanten
nicht
immer
ungetrübt
war,
erwies
sich
Georg
Neidlinger
als
sehr
großherzig.
So
unterstützte
er
bereits
1892
die
Kirchengemeinde
bei
der
Renovierung
der
„fast
baufällig
gewordenen
Kirche
in
namhafter
Weise.
Insbesondere
ließ
er
auf
eigene
Kosten
den
gotischen
Hochaltar
errichten.“
Auch
stellte
er
die
finanziellen
Mittel für das schmiedeeisene Eingangstor zum Pfarrgarten (alter Friedhof) zur Verfügung.
Neben der Elektrifizierung der Gemeinde bestritt er 1913 auch die Kosten von 708,50 Mark für die Installation des elektrischen Lichtes in der katholischen Kirche.
Zudem spendete er 1914 500 Mark für die Renovierung des katholischen Pfarrhauses in der Rathausstraße.
„Als
dann
in
letzter
Zeit,“
so
heißt
es
in
dem
bereits
zitierten
Nachruf
der
Ortsverwaltung
zum
Tode
Neidlingers,
„die
Renovierung
der
katholischen
Kirche
notwendig
wurde,
erklärte
sich
Herr
Neidlinger
aus
freien
Stücken
bereit,
einen
Großteil
der
Kosten
zu
übernehmen,
denn
er
wollte,
dass
dieser
altehrwürdige
Bau
wieder
würdig hergestellt werde.“ Ob ihm zuvor dabei auch der Kostenvoranschlag des Mainzer Dombaumeisters Becker über 27000 Mark bekannt geworden war ?
Es
ist
deshalb
nicht
verwunderlich,
dass
Herr
Lederer,
von
1913
bis
1932
katholischer
Pfarrer
von
Weinheim,
in
der
Gemeindechronik
lobend
vermerkt,
dass
Neidlinger „ein edler Protestant sei.“
In
dem
bereits
zitierten
Nachruf
weist
die
Ortsverwaltung
insbesondere
darauf
hin,
dass
Neidlinger
den
Armen
im
Dorf
alljährlich
an
Weihnachten
Geschenke
in
Naturalien
und
später
infolge
der
Kriegsverhältnisse
(des
1.
Weltkrieges)
auch
Geld
zukommen
ließ.
Darüber
hinaus
wussten
auch
Zeitzeugen
viel
Interessantes
zu
berichten:
„Wenn
er
hierherkam,
hat
er
viele
bedacht.
Die
Weinheimer
haben
sich
immer
gefreut,
wenn
er
seinen
Besuch
angekündigt
hat.“
Und
an
anderer
Stelle
heißt
es:
„Die
Leute,
die
im
Wingert
seiner
Familie
in
die
Weinlese
gingen,
entlohnte
er
fürstlich:
Zehn
Mark
pro
Tag
gab
es
für
die
Männer,
fünf
Mark
für
die
Frauen.
Und das bei einem Durchschnittslohn von 1,80 Mark, der 1910 gezahlt wurde. Deshalb wollten bei Neidlingers alle lesen gehen.“ (s. AZ: Er tat viel für Weinheim)
Ein
Jahr
vor
seinem
Tod
verwirklichte
Georg
Neidlinger
noch
einen
langgehegten
Wunsch
durch
die
Errichtung
einer
Kleinkinderschule
mit
einer
dazugehörigen
Schwesternwohnung.
Sie
wurde
allerdings
erst
am
5.
September
1920
in
Dienst
gestellt.
Dabei
handelte
es
sich
um
ein
Haus,
das
Neidlinger
seiner
Nichte
Maria
Trautwein
geb.
Balz
testamentarisch
vermacht
hatte.
Diese
stellte
dann
das
Gebäude
der
evangelischen
Kirchengemeinde
zur
Verfügung.
Die
Kosten
hierfür
übernahm
ebenfalls
Herr
Neidlinger.
Es
war
seine
letzte
Stiftung.
Doch
dieses
sehr
segensreiche
und
in
die
Zukunft
weisende
Werk
erlebte
der
Weinheimer
Ehrenbürger nicht mehr, denn er starb bereits am 20. April 1920 in Hamburg.
Gerne
hätte
er
wohl
seine
letzte
Ruhe
auf
dem
Friedhof
seiner
geliebten
Heimatgemeinde
gefunden.
Denn
hier
hatte
er
schon
lange
vorher
eine
monumentale
neoklassizistische
Grabstätte
mit
dorischer
Säulenstellung
unter
dem
Wahlspruch
„Die
Liebe
höret
nimmer
auf“
für
seine
Eltern,
seine
Geschwister
und
deren
Nachkommen
errichten
lassen.
Die
Überführung
seines
Leichnams
war
aber
damals
wegen
der
Rheinlandbesetzung
durch
die
Franzosen
und
den
damit
verbundenen Schwierigkeiten leider nicht möglich.
Abschließend
sei
noch
einmal
aus
dem
Nachruf
des
Weinheimer
Gemeinderats
zum
Tode
seines
großherzigen
Wohltäters
zitiert.
Hier
heißt
es:
„
So
floss
das
Leben
unseres
hochgeschätzten
Ehrenbürgers
hin
in
Arbeit
und
Wohltun...
Was
Herr
Neidlinger
für
die
Gemeinde
Weinheim
tat,
muss
jeder
ehrlich
Denkende
dankbar
anerkennen. Was er für sie war, das bezeugen auch in Zukunft noch die von ihm geschaffenen Werke.“
Gedenkstein:



27. September 1907


22. November 1907


28. April 1908


5. Februar 1909


14. April 1909


14. April 1909


30. Oktober 1909


10. November 1909


2. Dezember 1909


8. Dezember 1909


30. Juni 1910


31. Mai 1913

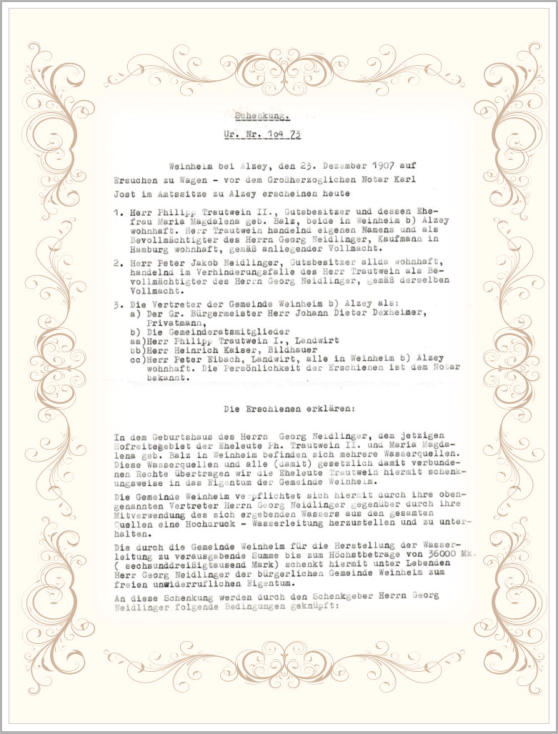
Design und Websitegestaltung by Gernot Loos © 2024
Dorfarchiv
Weinheim